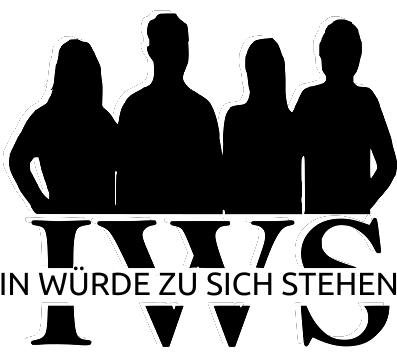IWS - in Würde zu sich stehen
Als ich vor einiger Zeit selbst noch stationär im BKH war, hab ich bereits zum ersten Mal das Plakat und die dazugehörigen Flyer gesehen:
IN WÜRDE ZU SICH STEHEN.
„Zum Abbau von Selbststigma* bei Erwachsenen mit psychischen Erkrankungen“.
Während ich mich also dafür verurteilte, schon wieder und immer noch krank zu sein und „mein Leben einfach nicht auf die Reihe zu kriegen“, sagte ich mir, dass ich sowas nicht brauchen würde - Selbststigma*? Das hab ich doch nicht.
Zu meinem Glück besuchte einige Zeit später, als ich bereits entlassen war, Claudia Schulz unsere Tagesstätte, um für das IWS (kurz für „in Würde zu sich stehen“) Programm zu werben.
Und schnell merkte ich, dass dieses Programm etwas ist, das ich unbedingt machen möchte und diese Thematik eigentlich sehrwohl sehr wichtig für mich ist.
Als ich also nach der Auslosung tatsächlich in der Gruppe war (es gibt bei Studien ja auch immer eine Kontrollgruppe) freute ich mich wirklich sehr.
Zusammen mit anderen Teilnehmer:innen und den zwei Peers* Claudia Schulz und ihrer Kollegin starteten wir noch am selben Abend die erste Gruppe.
Die vier Gruppensitzungen, in denen wir uns für je 2 Stunden mit diesem Thema beschäftigten, vergingen mir viel zu schnell und gerne wäre ich noch tiefer in die Materie eingestiegen.
Aber auch in dieser relativ knappen Zeit konnte ich viel für mich herausfinden und bin sehr froh teilgenommen zu haben.
Um meine Eindrücke und Erkenntnisse mit euch zu teilen, werde ich euch nun eine kleine Zusammenfassung der jeweiligen Stunden geben. Vielleicht könnt ihr ja noch was davon mitnehmen!
Das zentrale Thema des IWS-Programms war die Frage, ob bzw. in wie weit man seine Erkrankung offenlegen möchte oder nicht.
Denn wenn man wirklich würdevoll zu sich stehen möchte, dann gehört das ja dazu - oder?
Wie soll man zu sich stehen, wenn man die wichtigen Dinge, die einen zu einem gewissen Teil ausmachen, verheimlicht?
Oder ist das vielleicht alles gar nicht so schwarz und weiß wie man, oder zumindest ich, dachte?
In der ersten Lektion haben wir die Vor- und Nachteile von Offenlegung anhand eines Beispiels zwei fiktiver Menschen besprochen. Dabei ging es zunächst auch darum, welche Begriffe wir denn überhaupt für unsere Erkrankung verwenden möchten. Wollen wir überhaupt Erkrankung sagen? Oder passen vielleicht andere Wörter besser wie „seelisches Ungleichgewicht“ oder „instabil“ oder „Chaos im Kopf“?
Direkt danach ergründeten wir, wie viel Selbststigma* in uns steckt und wie sehr wir unter unserer eigenen Verurteilung leiden.
Wenn wir uns selbst schon stigmatisieren* ist es natürlich schwer unsere Erkrankung vor anderen Menschen offen zu legen ohne „einzuknicken“.
Zu sich stehen würde ja bedeuten, sich vor anderen (im Falle eines verbalen Angriffs) verteidigen zu können. Das wird aber natürlich schwer, wenn man den gemeinen Äußerungen von außen insgeheim im innen sogar zustimmt.
Wir sammelten anschließend Gründe für eine Offenlegung, das sind zum Beispiel:
das Geheimnis loswerden, Verständnis und soziale Kontakte, Unterstützung und Hilfestellung, Änderungen am Arbeitsplatz, Selbstwert/Selbstbild/Selbstbestimmung/Authentizität, Familie, Selbsthilfe und Peer Support, Stigma-Abbau und Klarheit. Natürlich kann es immer noch weitere persönliche Gründe geben.
Ich denke, wir wissen alle, dass es auch Gründe für eine Geheimhaltung gibt.
Bei der Diskussion in der Gruppe wurde schnell klar, dass der ausschlaggebende Grund, seine Erkrankung zu verheimlichen, meistens das Stigma* war, vor dem man sich dann natürlich (besser) schützen kann.
Es ist also vielleicht bequemer und oftmals durchaus auch sicherer lieber nichts preiszugeben und so zu tun als wäre man „ganz normal“ (was auch immer das sein soll), aber wie fühlen wir uns denn dann damit?
Zu meiner Erleichterung musste ich mal wieder feststellen, dass die Welt nicht schwarz oder weiß ist, sondern es auch noch Raum dazwischen gibt.
Raum zwischen „ich sag gar nichts“ und „ich erzähl dir meinen kompletten Leidensweg“.
Raum, den ich allein bestimmen darf, dessen Grenzen nur ich stecken kann, und den ich immer wieder anpassen und verändern darf.
Das lernten wir in der zweiten Lektion.
Es ging also um die verschiedenen Stufen und Möglichkeiten der Offenlegung.
Im IWS-Programm wurden die Stufen der Offenlegung folgendermaßen beschrieben:
1. Soziale Kontakte vermeiden und niemandem etwas erzählen
2. An Aktivitäten teilnehmen aber das Problem geheim halten
3. Nur bei ausgewählten Menschen offen legen
4. Uneingeschränkte Offenlegung, es ist egal ob es jemand evtl herausfindet
5. Aktive Verbreitung und Aktivismus (also das was die Peers jetzt im Rahmen der Studie machen)
Alles davon hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Für mich war besonders die ausgewählte Offenlegung (3.) interessant, eben weil es einen individuellen Mittelweg darstellt, und ich persönlich halte es auch für die beste Lösung.
Wir haben dann überlegt, bei welchen Personen wir am besten mit einer Offenlegung anfangen könnten.
Dafür sammelten wir Ideen, wie wir schon vorher herausfinden könnten, ob jemand „geeignet ist“. Zum Beispiel indem wir generell das Thema „psychische Erkrankungen“ ansprechen und anhand der Reaktion abwägen, wie sicher wir uns fühlen, uns zu öffnen. Reagiert die Person direkt mit Abwertung, ist es in dieser Situation vielleicht besser uns zu schützen. Reagiert sie offen, sind die Chancen hoch, dass die Reaktion bei uns persönlich ähnlich ausfallen wird.
Um uns besser vorbereitet zu fühlen, sind wir außerdem mögliche positive und auch negative Reaktionen durchgegangen und haben dies auch in einem kleinen Rollenspiel geübt. Es kann immer passieren, dass jemand uns etwas unfreundliches und auch verletzendes entgegnet. Dabei ist es gut, wenn wir uns vorbereitet fühlen auch damit umgehen zu können.
Aber was erzählen wir denn jetzt überhaupt?
Darum ging es in der dritten Lektion.
Wie erzählen wir unsere Geschichte am besten, wenn wir uns bei jemandem für eine Offenlegung entschieden haben?
Zusammen haben wir eine Geschichte gelesen, die original aus dem englischen stammt „don’t call me nuts“, in der es um den Krankheitsverlauf und die recovery* von Kyle geht und danach darüber diskutiert.
In unserem Workbook gab es dann vorgefertigte Abschnitte zum Ausfüllen, also zB wann die Erkrankung begann und wie wir zu recovery* gefunden haben.
Dadurch konnten wir uns einen guten Überblick über unseren Lebensweg verschaffen und damit dann entscheiden, was wir bei einer Offenlegung teilen würden und was lieber nur bei uns (und zB Behandlungspersonal) bleibt.
Am Ende fanden wir im Austausch noch einen guten Abschluss, indem wir reflektiert haben, was sich für uns verändert hat und wie wir das Thema Offenlegung in Zukunft meistern möchten.
Die letzte und vierte Lektion war der Auffrischungstermin, der etwas später als die anderen Termine erfolgte.
Dort haben wir darüber geredet ob und wenn ja wie wir unsere Erkrankung offen gelegt haben und wie es verlaufen ist.
Und nach dem Abschluss Fragebogen war es dann auch schon vorbei.
Obwohl es auf jeden Fall länger sein hätte können, hab ich sehr viel mitgenommen.
Ich kann mir jetzt „erlauben“ (ja, das ist mir persönlich sehr schwer gefallen) etwas nicht offen zu legen, und wenn es sein muss auch zu lügen um mich zu schützen.
Einmal wirklich ganz „offiziell“ das Stigma, das uns alle mit psychischer Erkrankung betrifft, als solches zu benennen, hilft mir dabei enorm.
Ich darf mich schützen und ich darf mich zeigen! Und vor allem darf ich allein entscheiden, wann sich was davon und in welcher Form WÜRDEVOLLER für mich anfühlt.
Ich muss mich nicht schämen für das, was ich (unter anderem) bin. Genauso wenig wie ich mich für die Symptome meiner Erkrankung schämen muss. Nicht vor anderen und auch nicht vor mir selbst.
Ich darf "IN WÜRDE ZU MIR STEHEN."
um das Stigma psychischer Erkrankung abzubauen